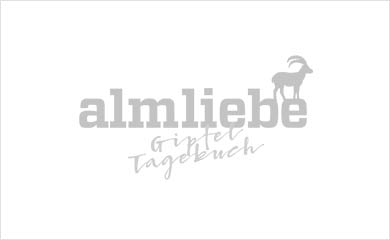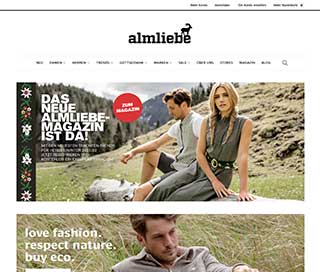Der neue Trend zu Heimat, Tradition und Natur ist auf dem Land noch nicht wirklich angekommen. Ehrliche Handarbeit wird höchstens in den Medien romantisiert. Kleine Läden am Land profitieren bisher noch kaum von der neuen Landlust. Aber es liegt eine Sehnsucht in der Luft, die die Zukunft prägen wird.
An einem Samstag im November in einer typischen niederbayerischen Kleinstadt: gähnende Leere in den Straßen der Innenstadt. Leerstände mitten im Ortskern. Nur am Kreisverkehr im hässlichen Gewerbegebiet vor den Toren des 15000 Einwohner-Ortes hat sich ein kleiner Stau gebildet. Die Autos biegen ab zu Lidl, Kik, Obi und Co. Tristesse nicht nur wegen der Nebelschleier, die alles in trostloses Grau hüllen. Die Berge sieht man ohnehin nur bei extremer Fönwetterlage. Neue Liebe zu Heimat, Natur und Tradition, über die nicht nur Magazine wie Landlust immer wieder schreiben? Hier spürt man sie jedenfalls nicht. Auch die ortsansässigen Einzelhändler berichten nicht gerade vom neuen Run auf ihre Region und ihre Geschäfte und auch nicht von Horden an Ausflüglern und Städtern, die ihre Liebe zum Land entdeckt haben.
Szenenwechsel. Derselbe Samstag im bayerischen Oberland. Stop and Go Richtung Tegernsee. Stundenlang müssen landlustige Münchner auf verstopften Landstraßen zu Almhütten und Bergrestaurants kriechen. Die langwierige Anfahrt scheint nicht sonderlich abzuschrecken, wenn der Lohn dafür idyllische Wanderwege, urige Lokale und Natur pur sind, die einen schönen Kontrast zum stressigen Stadtleben bieten. Dass Bergwandern gerade auch bei jungen Leuten eine Renaissance erlebt, ist unbestritten. Outdoor-Anbieter profitieren seit geraumer Zeit von der neuen Wanderlust und Naturliebe der Großstädter. Aber wirkt sich der Trend auch positiv auf Einwohnerzahl und Einzelhandelsstruktur in der Kleinstadt aus? Erblühen das Leben und der Handel fernab vom hektischen Großstadttrubel?
Allein die nackten Zahlen sprechen dagegen. Hat 1994 knapp 19% der deutschen Gesamtbevölkerung in ländlicher Umgebung gewohnt, so waren es 2010 nur noch 14%. „Wenn die prozentualen Veränderungen auch gering ausfallen, so kann man immer noch von Landflucht sprechen, da die Bevölkerung im ländlichen Bereich konstant rückläufig ist und die städtische jährlich ansteigt“, sagt Susanne Becker vom Statistischen Bundesamt. Die überwiegende Mehrheit der gut ausgebildeten Jugend zieht es noch immer in die Metropolen. Insbesondere auch durch den demografischen Wandel sind die ländlichen Einwohnerzahlen vielerorts rückläufig. Viele Kleinstädte und Dörfer nicht nur in Ostdeutschland klagen über fehlende Arztpraxen, Dorfschulen, Banken, Gasthäuser, Poststellen, Banken und sogar Kirchen. Und es ist fraglich, ob die Verödung der Kleinstädte zumindest außerhalb von Ferienregionen durch eine neue Gesinnung, die das Zukunftsinstitut in Kelkheim 2008 schon mit dem Begriff Neo Nature versehen hat, aufgehalten werden kann. „Den Städten und Gemeinden ist es ein wichtiges Anliegen, der Verödung von Innenstadtbereichen wirksam entgegenzutreten. Regelmäßig werden Konzepte in Zusammenarbeit von Handel und Kommune entwickelt, die die Chance bieten, gerade regionale Besonderheiten zu etablieren und sich mit dem Themenfeld Natur, Ökologie und Tradition zu befassen“, sagt Dr. Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Soweit die Theorie. Die Praxis sieht vielerorts anders aus, weiß auch Barbara Gruber vom Gewandhaus Gruber in Erding, 35 Kilometer von München entfernt. Dennoch ist ihr das Phänomen Landlust in letzter Zeit häufiger begegnet, nicht nur weil sie immer mehr Lederhosen und Dirndl verkauft, ja von einem wahren Trachten-Boom sprechen kann. „Zunächst war das auf bestimmte Anlässe wie auf Volksfeste beschränkt. Aber mittlerweile hat das Echte, Traditionelle auch im normalen Alltag eine Berechtigung. Wir verkaufen jetzt auch vermehrt urige Janker, Strickjacken und Trachtenblusen zu Jeans und Chino.“ Gruber spricht auch von der Sehnsucht nach Wertbeständigkeit, die sie bei ihren Kunden ausmacht. Nur dass sich der Wertewandel extrem auf den Handel in den ländlichen Regionen auswirkt, kann sie nicht bestätigen: „In den 1970er, 1980er Jahren war es extrem schick, in die Stadt zu fahren. Das machen heute natürlich auch noch viele. Aber es nimmt nicht mehr zu.“ Das liegt wahrscheinlich aber eher daran, dass Gruber mittlerweile auf 5.000 Quadratmetern Mode verkauft und von Esprit über Boss bis Gerry Weber alles bietet, was der Kunde braucht. Darüberhinaus versucht das Familienunternehmen, sich über guten Service und individuellen Markenmix von der breiten Masse abzuheben.
„Das große Problem von Händlern auf dem Land ist, dass sie immer ein sehr breites Spektrum an Marken und Modellen anbieten müssen, um mit dem riesigen Angebot in der Großstadt halbwegs mithalten zu können.“ Florian Ranft, Komet&Helden.
Ein paar Kilometer weiter in Freising sieht es schon anders aus. Dort hat Gruber vor kurzem einen neuen Laden eröffnet und kämpft mit den üblichen Problemen. Mit der grünen Wiese, mit veralteten Strukturen und der fehlenden Attraktivität des Stadtkerns. Kleine interessante Läden findet man hier kaum. Das Sterben des individuellen Einzelhandels ist laut BTE nicht gestoppt, der Konzentrations-Prozess nimmt weiter zu. Betroffen sind vor allem kleinere Modegeschäfte mit Nettoumsätzen unter fünf Millionen Euro. Waren im Jahr 2000 noch 34 823 Unternehmen am Markt vertreten, so ist die Zahl im Jahr 2009 auf nur noch 23 771 gefallen. So mancher beobachtet jedoch einen langsamen Gegentrend. „Diejenigen Händler, die es heute noch auf dem Land gibt, bleiben auch. Sie haben sich auf den Mikromarkt und auf den Bedarf vor Ort eingestellt“, sagt Michael Prues von der Vertriebsagentur Raab & Prues in München. „Es gibt interessante neue Geschäfte am Land, die neue Wege gehen. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt überall neue Shops aufpoppen.“
Davon kann auch Markus Kuttenreich ein Lied singen. Er betreibt in Ingolstadt auf 120 Quadratmetern den Männermodeladen „Kuttenreich“ mit Marken wie Boss Black, Barbour, Polo Ralph Lauren und Better Rich. Große Einkaufs- und Outletcenter schwächen die Frequenz in der Innenstadt. „Natürlich fahren viele zum Einkaufen weg, weil es hier keine große Auswahl mehr gibt. Es fehlen die Magneten“, so Kuttenreich. Über die Jahre ist sein Sortiment immer hochwertiger geworden und spezieller, „das Andere bekommen die Leute doch überall.“
Globale Konkurrenz. Und zwar nicht nur im Outlet-Center in Ingolstadt oder in München sondern auch im World Wide Web. Mytheresa, Jades24, Myclassico und Co. sind zu unmittelbaren Konkurrenten geworden, die allesamt über wachsende Verkäufe in ländliche Gebiete berichten können. „Mittlerweile bekommt man alles im Internet, auch sehr hochwertige Bekleidung. Das stellt natürlich die Exklusivität in Frage“, sagt Michael Prues. „Die stationären Händler sind gefordert, dass sie richtig Lust machen auf Einkaufen und gut beraten. Denn es wird immer schwierig sein, einen Brioni-Anzug im Internet zu kaufen.“ Brioni ist vielleicht die Ausnahme. Dennoch konnte der auf Textilien und Bekleidung spezialisierte Internet- und Versandhandel laut statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr 2011 ein Umsatzwachstum von 4,6 Prozent verzeichnen und wird zu einem immer stärkeren Mitbewerber des stationären Modefachhandels. „Traditionell haben wir viele Kunden aus dem ländlichen Raum und die Zuwachsraten entwickeln sich weiterhin sehr positiv“, sagt Stefan Puriss, CEO von frontlineshop. „Da sich die realen Angebotsstrukturen in den Vorstädten und ländlichen Gebieten tendenziell zurückentwickeln, besteht automatisch eine noch größere Nachfrage nach Versandhandelsangeboten. Das merken wir unmittelbar.“
Die Ausnahme bestätigt die Regel. In der Ferienregion Chiemsee und speziell im 10 000 Einwohner-Ort Prien gibt es eine Markendichte, die ihresgleichen sucht. Im April hat zum Beispiel das männliche Pedant zum DOB-Laden Scala aufgemacht auf 70 Quadratmetern mit hochwertigen Marken wie Jil Sander, Dries van Noten, Marc by Marc Jacobs, Frauenschuh, Acne und Golden Goose. „Wir spüren die neue Lust am Landleben und an den Bergen ganz klar. Viele Städter haben sich in der letzten Zeit Zweitwohnungen hier gekauft“, sagt Inhaber Georg Eder. „Der Chiemsee ist sehr attraktiv und insbesondere die Preise im Vergleich zu München. Außerdem schätzen unsere Kunden die ruhige Einkaufssituation und den Kontakt zu den Inhabern.“ Auch der Laden Lin & Co von Norbert Reipert, der zusammen mit seiner Frau das Cashmere-Label Villa Gaia führt, entwickelt sich positiv. Zu 70 Prozent besteht das Sortiment aus Villa Gaia, abgerundet mit Drykorn, Schuhen und Accessoires. 3.000 Teile werden dort jährlich gekauft, nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen. „Ich glaube, im ländlichen Bereich findet der Wertewandel schneller statt, weil die Menschen näher an der Natur sind“, sagt Reipert. „Der ökologische und soziale Aspekt der Produktion gehört auch zum Thema Landlust. Der Endverbraucher ist vermehrt geneigt, nachhaltige, in Europa produzierte Ware zu kaufen, wenn sie mit anderen Produkten auf dem gleichen Niveau ist was Preis, Design und Funktion betrifft.“
Konsumlust verbunden mit gutem Gewissen. Das sei die Zukunft und zwar nicht nur am Land. Das ist auch das Credo von Till Reiter, Inhaber der Marke Ludwig Reiter, die für hochwertige, rahmengenähte Schuhe steht, gefertigt vor den Toren Wiens. Dorthin ist Reiter mit seiner Firma gezogen. Bewusste Stadtflucht kann man das wohl nicht nennen, aber Reiter genießt die klassische Dorf-Struktur mit Gutshof, Kapelle, Wäldern und Landwirtschaft.
Genauso wie viele Kreative, die bewusst auf Vogelgezwitscher statt Verkehrslärm setzen. Das Fachmagazin Computer Woche hat groß über die neue Landlust der IT-Kreativen berichtet als Gegentrend zur Virtualisierung. „Das ist aber immer noch ein Minderheitenprogramm für Leute, die die Milch vom Bauern und das Brot vom Bäcker kaufen wollen und gerne im Garten arbeiten“, sagt Reiter. Zumindest bekommt er die Romantisierung der Natur und der ehrlichen Handarbeit in seinem Betrieb kaum zu spüren. „Es ist schwierig Leute zu finden. Handwerkliche Berufe will keiner lernen. Deshalb müssen wir selbst ausbilden.“ Ähnliches berichtet Anja Grabherr-Petter vom Strick-Label Phil Petter in Vorarlberg: „Hier gibt es eine lange Stricker-Tradition. Aber leider gibt es heute nur noch uns. Insofern gibt es auch die entsprechenden Schulen nicht mehr, das Berufsbild ist verlorengegangen.“ Der Endverbraucher jedoch schätze das ehrliche Handwerk vermehrt. „Die Leute sind sensibler geworden und kaufen intelligenter ein. Da ist Made in Österreich wieder ein Argument.“
Die Landlust, sie hat viele Facetten. Sie ist eine leise Revolution, die alle Lebensbereiche umfasst. Am unmittelbarsten profitiert derzeit noch der Tourismus, urige Alpendörfer in Österreich und Südtirol florieren. „All diese alpinen Wellness-Konstrukte scheinen hervorragend zu funktionieren. Es ist sozusagen eine virtuelle Landliebe der Städter“, sagt Till Reiter. Florian Ranft ist da ganz seiner Meinung: „Das Thema Landlust bezieht sich momentan mehr auf Wohnen und Freizeit als auf Einkaufen.“ Den Langzeittrend leugnen kann indes keiner mehr. Er wird das Kaufverhalten, den Einzelhandel, die Zukunft prägen. In der Stadt wie auf dem Land.
Sonja Ragaller
Artikel erschienen 2012 in der Style in Progress: